Die Jahresabrechnung in der Wohnungseigentumsgemeinschaft (WEG)
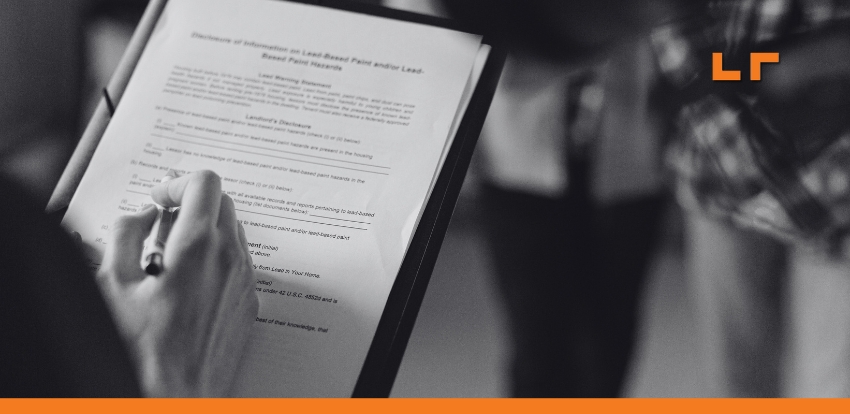
Liebert & Röth Rechtsanwälte, wir machen WEG-Recht in Berlin & bundesweit
Rechte, Pflichten und aktuelle Rechtsprechung
Als Eigentümer einer Wohnung in einer Wohnungseigentumsgemeinschaft (WEG) gehört die jährliche Abrechnung zu den wichtigsten Dokumenten, die Sie von Ihrer Verwaltung erhalten. Die Jahresabrechnung – auch als WEG-Abrechnung oder Hausgeldabrechnung bezeichnet – legt transparent dar, welche Kosten im vergangenen Jahr angefallen sind und wie diese auf die einzelnen Eigentümer verteilt werden. In diesem Beitrag erläutern wir Ihnen als Rechtsanwälte für WEG-Recht die rechtlichen Grundlagen, Inhalte und Fristen der Jahresabrechnung sowie die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.
Was ist die Jahresabrechnung einer WEG?
Die Jahresabrechnung ist gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 WEG die zentrale Abrechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Wohnungseigentümergemeinschaft für ein abgelaufenes Geschäftsjahr. Sie stellt nach Ablauf des Wirtschaftsjahres die tatsächlich angefallenen Kosten zusammen und vergleicht diese mit den geleisteten Vorauszahlungen (Hausgeld) der Eigentümer.
Die Jahresabrechnung erfüllt mehrere wesentliche Funktionen:
- Sie schafft Transparenz über die finanzielle Verwaltung des Gemeinschaftseigentums
- Sie dokumentiert die ordnungsgemäße Verwendung der Hausgelder
- Sie bildet die Grundlage für die Beschlussfassung über Nachschüsse oder Gutschriften (sogenannte Abrechnungsspitzen)
- Sie dient als Kontrollinstrument für die Verwaltung
Rechtlich ist die Jahresabrechnung von der Hausgeldabrechnung zu unterscheiden, auch wenn die Begriffe häufig synonym verwendet werden. Die Hausgeldabrechnung zeigt auf, wie das von den Eigentümern gezahlte Hausgeld verwendet wurde. Die Jahresabrechnung ist umfassender und beinhaltet zusätzlich die Entwicklung der Instandhaltungsrücklage sowie eine Gesamtübersicht über die finanzielle Situation der WEG.
Rechtsgrundlagen der Jahresabrechnung
Die Pflicht zur Erstellung der Jahresabrechnung ergibt sich aus mehreren gesetzlichen Vorschriften:
- 28 Abs. 2 Satz 2 WEG verpflichtet zur Aufstellung einer Abrechnung nach Ablauf des Kalenderjahres
- 28 Abs. 3 WEG regelt die Aufstellung durch den Verwalter
- § 666, 675, 259 BGB enthalten ergänzende Pflichten zur Rechnungslegung aus dem Geschäftsbesorgungsrecht
Seit der WEG-Reform zum 1. Dezember 2020 hat sich die Rechtslage grundlegend geändert. Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 19. April 2024 (BGH V ZR 167/23) klargestellt, dass der Anspruch auf Erstellung der Jahresabrechnung nicht mehr gegen den Verwalter, sondern gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gerichtet ist. Der Verwalter ist lediglich das ausführende Organ der Gemeinschaft.
Bei der Erstellung sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu beachten. Die Jahresabrechnung wird nach dem Zufluss- und Abflussprinzip erstellt, nicht wie eine Bilanz. Es handelt sich um eine reine Einnahmen- und Ausgabenrechnung.
Inhalt und Bestandteile der Jahresabrechnung
Eine vollständige Jahresabrechnung muss folgende Komponenten enthalten:
Gesamtabrechnung:
- Sämtliche Einnahmen (Hausgeldzahlungen, Mieteinnahmen aus Gemeinschaftseigentum, Zinserträge)
- Alle Ausgaben (Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Betriebskosten, Verwaltungskosten, Versicherungen)
- Entwicklung der Instandhaltungsrücklage mit Anfangsbestand, Zuführungen, Entnahmen und Endbestand
Der BGH hat mit Urteil vom 20. September 2024 (BGH V ZR 195/23) entschieden, dass in der Jahresabrechnung sowohl die tatsächlichen als auch die geschuldeten Zahlungen der Wohnungseigentümer zur Instandhaltungsrücklage dargestellt werden müssen. Die Instandhaltungsrücklage ist dabei weder als Ausgabe noch als sonstige Kosten zu buchen, sondern stellt ein Bestandskonto dar.
Einzelabrechnungen:
- Für jeden Wohnungseigentümer ist eine individualisierbare Einzelabrechnung zu erstellen
- Diese zeigt die auf die jeweilige Einheit entfallenden Kosten nach dem vereinbarten Verteilerschlüssel
- Darstellung der geleisteten Vorauszahlungen und der sich ergebenden Abrechnungsspitze (Nachzahlung oder Guthaben)
Verteilerschlüssel:
- Dokumentation, nach welchem Schlüssel (z.B. nach Miteigentumsanteilen, Wohnfläche oder Verbrauch) die Kosten verteilt wurden
Vermögensübersicht:
- Eine Gesamtdarstellung der finanziellen Situation der WEG
- Nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben, aber sehr nützlich und empfehlenswert
Beschlussfassung über die Jahresabrechnung nach der WEG-Reform
Seit der WEG-Reform 2020 hat sich die Beschlussfassung über die Jahresabrechnung grundlegend geändert. Nach § 28 Abs. 2 Satz 1 WEG beschließen die Wohnungseigentümer nicht mehr über die gesamte Jahresabrechnung, sondern nur noch über die in den Einzelabrechnungen ausgewiesenen Nachschüsse oder die Anpassung der beschlossenen Vorschüsse – also über die sogenannten Abrechnungsspitzen.
Der Bundesgerichtshof hat hierzu mit Urteil vom 19. Juli 2024 (BGH V ZR 102/23) wichtige Klarstellungen getroffen:
Ein Beschluss, durch den „die Gesamtabrechnung und die daraus resultierenden Einzelabrechnungen des Hausgeldes genehmigt werden", ist nicht mangels Beschlusskompetenz nichtig.
Vielmehr ist dieser Beschluss normgerecht dahingehend auszulegen, dass die Wohnungseigentümer damit lediglich die Höhe der Abrechnungsspitzen festlegen wollten.
Diese Rechtsprechung schafft Rechtssicherheit für die Praxis und verhindert, dass Beschlüsse allein wegen einer nicht exakt dem Gesetzestext entsprechenden Formulierung angefochten werden können.
Fristen für die Erstellung und Vorlage der Jahresabrechnung
Das Wohnungseigentumsgesetz enthält keine ausdrückliche gesetzliche Frist für die Erstellung der Jahresabrechnung. Häufig sind Fristen jedoch in der Teilungserklärung oder im Verwaltervertrag geregelt.
Nach der Rechtsprechung der Obergerichte muss die Jahresabrechnung wohl innerhalb von drei bis sechs Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres erstellt werden. Das Gesetz selbst enthält hierzu keine festen Fristen.
Für das Wirtschaftsjahr 2024 bedeutet dies, dass der Verwalter die Abrechnung bis spätestens 30. Juni 2025 erstellt haben sollte.
Eine interessante neuere Entscheidung stammt vom Landgericht Koblenz (Urteil vom 5. Februar 2024, Az. 2 S 34/23 WEG), das betont, dass aus dem WEG keine konkrete Frist abzuleiten sei. Das Gericht hält es für ausreichend, wenn die Beschlussfassung über die Abrechnungsspitzen vor Ablauf des Folgejahres unter Einhaltung der dreiwöchigen Einladungsfrist möglich ist. Diese Ansicht ist jedoch umstritten.
Jahresabrechnung bei Verwalterwechsel
Ein häufiges Praxisproblem stellt die Frage dar, wer bei einem Verwalterwechsel für die Erstellung der Jahresabrechnung zuständig ist. Der Bundesgerichtshof hat hierzu mit Urteil vom 26. September 2025 (BGH V ZR 206/24) grundlegende Klarstellungen getroffen:
Nach einem Verwalterwechsel ist grundsätzlich der neue, amtierende Verwalter verpflichtet, auch ausstehende Abrechnungen für Vorjahre zu erstellen. Dies gilt sowohl für einen Wechsel während als auch zum Ende eines Kalenderjahres. Der ausgeschiedene Verwalter ist nicht mehr das für die Aufstellung der Jahresabrechnung zuständige Organ.
Die Pflicht der Gemeinschaft zur Erstellung der Jahresabrechnung entsteht nach Ansicht des BGH am 1. Januar des Folgejahres. Ein Verwalter, dessen Amtszeit zum 31. Dezember geendet hat, ist daher aus dem Verwaltervertrag grundsätzlich nicht mehr verpflichtet, die Jahresabrechnung für das Vorjahr zu erstellen – es sei denn, im Verwaltervertrag wurde etwas anderes vereinbart.
Allerdings schuldet der ausgeschiedene Verwalter der Gemeinschaft Rechnungslegung und muss dafür einstehen, dass er die im Abrechnungszeitraum angefallenen Einnahmen und Ausgaben vollständig und richtig erfasst und mitgeteilt hat. Der neue Verwalter kann somit auf die Unterlagen des Vorgängers zurückgreifen.
Prüfung und Anfechtung der Jahresabrechnung
Vor der Beschlussfassung in der Eigentümerversammlung soll gemäß § 29 Abs. 3 WEG der Verwaltungsbeirat – sofern ein solcher bestellt ist – die Jahresabrechnung prüfen und mit seiner Stellungnahme versehen.
Die Wohnungseigentümerversammlung genehmigt sodann die Abrechnungsspitzen durch Mehrheitsbeschluss nach § 25 Abs. 1 WEG. Stellt ein Eigentümer Fehler in der Jahresabrechnung fest, kann er den Beschluss über die Abrechnungsspitzen innerhalb der Anfechtungsfrist von einem Monat gemäß § 46 WEG durch Anfechtungsklage beim zuständigen Amtsgericht anfechten.
Wegweisende Entscheidungen zur Anfechtung:
Der BGH hat mit Urteil vom 20. September 2024 (BGH V ZR 195/23) klargestellt, dass Fehler in der Jahresabrechnung nur dann zur Anfechtbarkeit des Beschlusses über die Einforderung von Nachschüssen führen, wenn sie die Abrechnungsspitze und damit die Zahlungspflicht der Eigentümer tatsächlich beeinflussen. Rein formale Mängel im Zahlenwerk ohne Auswirkung auf die Höhe der Nachzahlung genügen nicht.
Eine Grundsatzentscheidung hat der BGH mit Urteil vom 11. April 2025 (BGH V ZR 96/24) zur Teilanfechtung getroffen: Ein Beschluss über Nachschüsse oder die Anpassung von Vorschüssen kann auch nur teilweise für ungültig erklärt werden, sofern es sich um eine rechnerisch selbstständige und abgrenzbare fehlerhafte Kostenposition handelt und anzunehmen ist, dass die Eigentümer den Beschluss auch ohne diesen Teil gefasst hätten. Diese Entscheidung ermöglicht eine gezielte Korrektur einzelner Fehler, ohne dass der gesamte Beschluss angefochten werden muss.
Häufige Fehlerquellen in der Jahresabrechnung
In der Praxis treten immer wieder typische Fehler in Jahresabrechnungen auf, die Sie als Eigentümer kennen sollten:
- Falsche Kostenzuordnungen: Kosten, die nicht auf die Gemeinschaft umgelegt werden dürfen, werden dennoch abgerechnet
- Mathematische Fehler: Rechen- oder Übertragungsfehler bei der Addition von Positionen
- Nicht berücksichtigte Nachlässe oder Rabatte: Vereinbarte Preisnachlässe werden in der Abrechnung nicht berücksichtigt
- Verwendung veralteter Verteilerschlüssel: Es wird nicht der aktuell beschlossene Verteilerschlüssel angewendet
- Fehlerhafte Behandlung der Instandhaltungsrücklage: Rücklagenentnahmen werden fälschlich wie Ausgaben behandelt
Besonders kritisch ist die fehlerhafte Behandlung von Rücklagen. Der BGH hat im Urteil vom 11. April 2025 (BGH V ZR 96/24) deutlich gemacht, dass Entnahmen aus der Instandhaltungsrücklage rechnerisch vollständig neutralisiert werden müssen. Bereits angesparte Gelder dürfen nicht wie neue Ausgaben behandelt werden, die über die Jahresabrechnung umgelegt werden.
Verspätete Jahresabrechnung und Konsequenzen für Vermieter
Eine verspätete Jahresabrechnung hat besonders gravierende Folgen für Eigentümer, die ihre Wohnung vermietet haben. Nach § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB muss die Betriebskostenabrechnung dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums zugehen. Für den Abrechnungszeitraum 2024 bedeutet dies: Die Betriebskostenabrechnung muss dem Mieter bis spätestens 31. Dezember 2025 vorliegen.
Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 25. Januar 2017 (BGH VIII ZR 249/15) ausdrücklich entschieden, dass eine fehlende oder verspätete WEG-Jahresabrechnung die Jahresfrist für die Betriebskostenabrechnung nicht verlängert. Der Vermieter muss also die Betriebskostenabrechnung auch dann fristgerecht erstellen, wenn die WEG-Abrechnung noch nicht vorliegt oder noch nicht beschlossen wurde. Dies gilt selbst dann, wenn nicht der Vermieter, sondern die Hausverwaltung die Verspätung zu vertreten hat.
In der Praxis bedeutet dies für vermietende Eigentümer:
- Sie müssen die Betriebskostenabrechnung notfalls auf Grundlage der verfügbaren Unterlagen und unter Nutzung des Einsichtsrechts nach § 18 Abs. 4 WEG erstellen
- Nötige Schätzungen sollten transparent gekennzeichnet werden
- Etwaige Korrekturen können nachgereicht werden, ohne die Jahresfrist zu verletzen
Verliert der Vermieter durch eine verspätete WEG-Abrechnung seinen Anspruch auf Nachzahlungen gegenüber dem Mieter, kann er unter Umständen Schadensersatzansprüche gegen den Verwalter geltend machen, sofern dessen Verzug ursächlich war.
Tipps zur Prüfung der Jahresabrechnung für Eigentümer
Als Wohnungseigentümer sollten Sie die Jahresabrechnung sorgfältig prüfen, um Fehler oder Unstimmigkeiten rechtzeitig zu erkennen. Folgende Prüfpunkte sind besonders wichtig:
Formale Vollständigkeit:
- Enthält die Abrechnung eine Gesamtabrechnung mit allen Einnahmen und Ausgaben?
- Liegt eine individuelle Einzelabrechnung für Ihre Wohnung vor?
- Ist die Entwicklung der Instandhaltungsrücklage dargestellt?
- Sind die verwendeten Verteilerschlüssel dokumentiert?
Inhaltliche Prüfung:
- Stimmen die ausgewiesenen Kontostände mit den tatsächlichen Kontoständen überein?
- Sind alle Positionen durch Belege nachgewiesen?
- Wurden die richtigen Verteilerschlüssel angewendet?
- Sind Hausgeldrückstände erfasst und werden Maßnahmen zur Eintreibung ergriffen?
Mathematische Kontrolle:
- Addieren Sie den Anfangsbestand und alle Einnahmen
- Ziehen Sie alle Ausgaben ab
- Das Ergebnis muss mit dem ausgewiesenen Endbestand übereinstimmen
Rechtliche Hinweise:
- Die Anfechtungsfrist beträgt einen Monat ab Beschlussfassung nach § 46 WEG
- Bei Zweifeln sollten Sie frühzeitig fachkundigen Rat einholen
- Eine Anfechtungsklage muss beim zuständigen Amtsgericht erhoben werden
Empfänger der Jahresabrechnung und Übergang bei Eigentümerwechsel
Adressat der Jahresabrechnung ist derjenige Eigentümer, der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Abrechnung in der Wohnungseigentümerversammlung im Grundbuch eingetragen ist. Dies hat wichtige praktische Konsequenzen beim Verkauf einer Eigentumswohnung:
- Der Zeitpunkt der Grundbuchumschreibung ist entscheidend dafür, ob eine Forderung aus der Jahresabrechnung vom Verwalter gegen den Verkäufer oder gegen den Käufer geltend gemacht werden muss
- Die gleiche Person ist auch Empfänger eines Guthabens aus der Jahresabrechnung
- Selbst für Forderungen aus Abrechnungen früherer Jahre haftet der Erwerber, wenn er zum Zeitpunkt des Beschlusses über diese Jahresabrechnungen bereits Eigentümer ist
Allerdings fallen dem Käufer nicht die Fehlbeträge zur Last, die dadurch entstanden sind, dass der Verkäufer während seiner Eigentümerzeit die beschlossenen Hausgeldzahlungen nicht vollständig erbracht hat. In einem solchen Fall bleibt der Verkäufer Schuldner dieser Vorauszahlungen.
In Kaufverträgen über Eigentumswohnungen werden regelmäßig Bestimmungen zum Übergang von Nutzen und Lasten getroffen. Diese Vereinbarungen gelten jedoch nur zwischen Käufer und Verkäufer im Innenverhältnis. Die Rechte der Wohnungseigentümergemeinschaft können dadurch nicht beschränkt werden. Der Kaufvertrag bietet jedoch die Möglichkeit zum Ausgleich zwischen Käufer und Verkäufer.
Fazit
Die Jahresabrechnung einer Wohnungseigentumsgemeinschaft ist ein komplexes Dokument mit weitreichenden rechtlichen und finanziellen Konsequenzen. Die WEG-Reform 2020 und die nachfolgende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs haben wichtige Klarstellungen gebracht, insbesondere zur Beschlussfassung und zur Anfechtung von Jahresabrechnungen.
Als Wohnungseigentümer sollten Sie die Jahresabrechnung sorgfältig prüfen und bei Fehlern oder Unklarheiten zeitnah reagieren.
Die einmonatige Anfechtungsfrist des § 46 WEG erfordert schnelles Handeln. Vermietende Eigentümer müssen zudem die strengen Fristen für die Betriebskostenabrechnung im Blick behalten.
Bei Fragen zur Jahresabrechnung Ihrer Wohnungseigentumsgemeinschaft, bei Unstimmigkeiten in der Abrechnung oder bei der Prüfung von Beschlüssen stehen wir Ihnen als spezialisierte Rechtsanwälte für Wohnungseigentumsrecht gerne zur Verfügung.
Mehr zum Thema WEG-Recht finden Sie auch auf unserer Website in der Kategorie Wohnungseigentumsrecht.
Mehr zum Autor Rechtsanwalt Martin Liebert finden Sie unter RA Martin Liebert.

